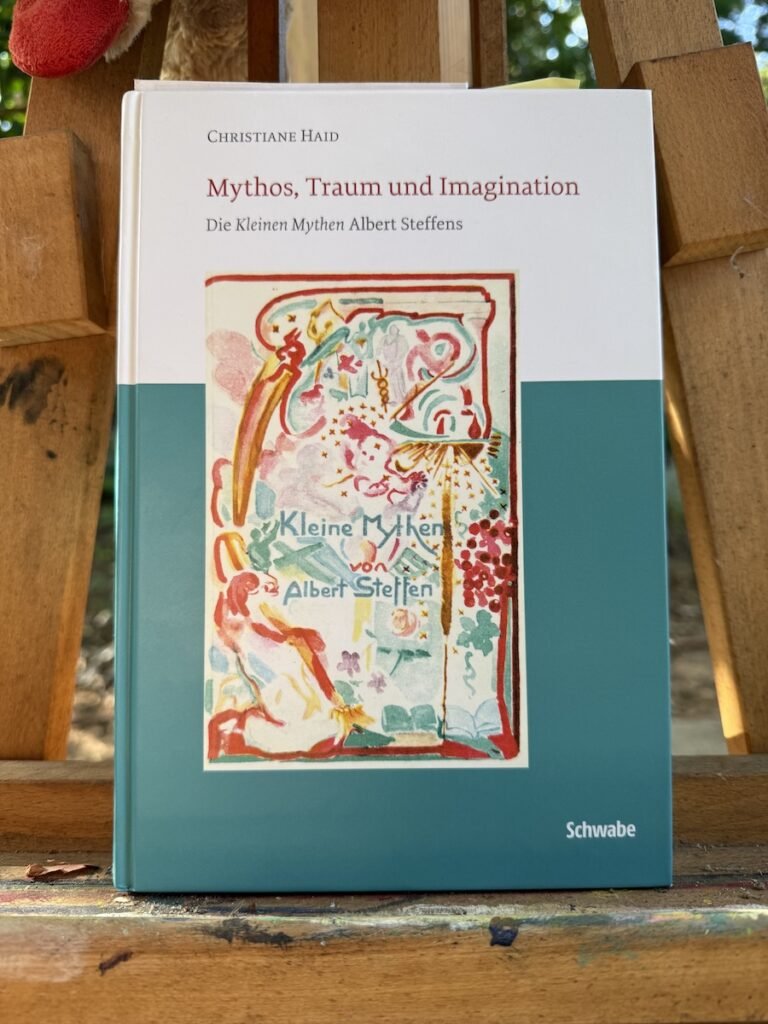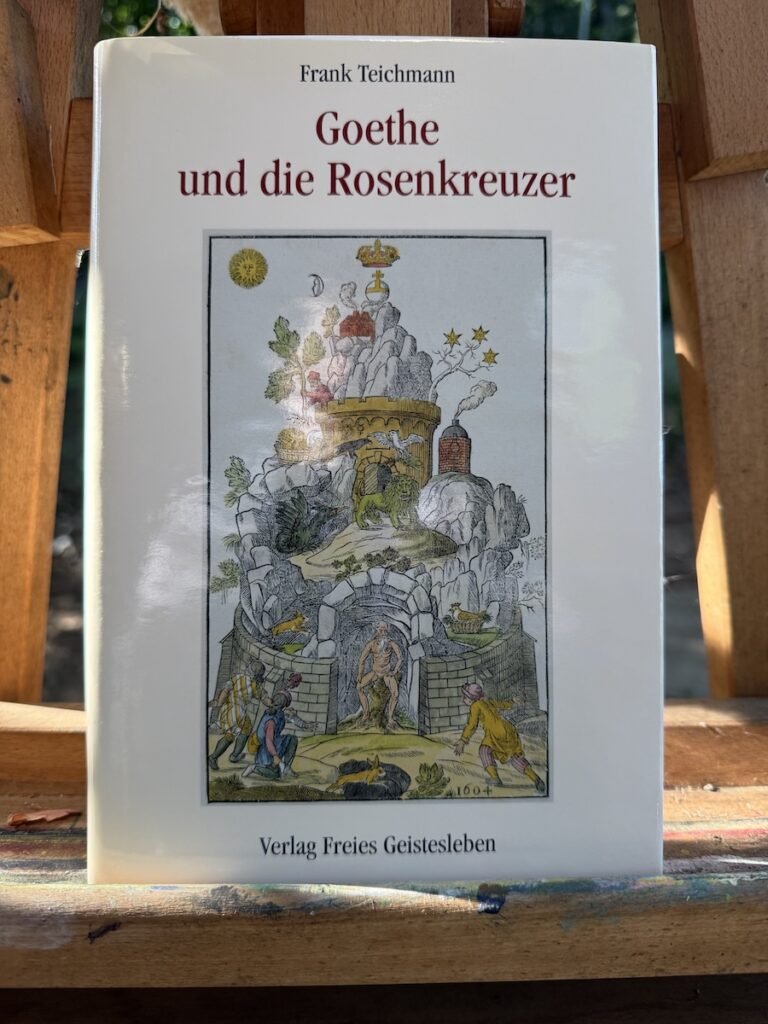Sektionsleiterin Christiane Haid & STIL Herausgeberin Ariane Eichenberg
Liebe Freunde:
STIL ist eine vierteljährlich erscheinende Zeitschrift der Sektion für Literatur und Geisteswissenschaften und der Sektion für Bildende Künste. Beide Sektionen stehen unter der Leitung von Christiane Haid. Ich habe berichtet über STIL im Laufe der Jahre mehrmals auf dieser Website. Der jüngste Beitrag betraf die Ausgabe vom Juni 2025 (St. John's).
STIL ist in deutscher Sprache für nordamerikanische Leser als Einzelausgabe erhältlich. Klicken Sie hier für Informationen.
Zurzeit ist diese hervorragende Publikation nur in deutscher Sprache erhältlich, aber es gibt Bestrebungen, eine englischsprachige Ausgabe herauszubringen. Dies ist eines der Themen, die im folgenden Interview angesprochen werden. Dieses Interview erschien erstmals zu Michaeli 2025 auf der Website der Anthroposophischen Gesellschaft Deutschland (AGiD.Aktuell). Das Interview wurde von Olivia Girard geführt. Ich habe es mit Genehmigung übersetzt.
Einführung
STIL Die Zeitschrift wurde 1979 von Wilhelm Oberhuber unter dem Titel STIL: Goetheanistisches Bilden und Bauen. Seit 2009 erscheint es vierteljährlich im Verlag am Goetheanum unter dem erweiterten Titel STIL: Goetheanismus in Kunst und Wissenschaft. Michael Kurtz übernahm 2009 die Herausgeberschaft von Wilhelm Oberhuber und übergab sie 2020 an Ariane Eichenberg und Christiane Haid. STIL wurde damit zum Organ der Sektion für Schöne Wissenschaften (Sektion für Literatur- und Geisteswissenschaften) und der Sektion für Bildende Künste und wird seit April 2025 von beiden Sektionen herausgegeben. Im Laufe der Jahre, STIL hat sich zu einem wichtigen Forum für künstlerische und wissenschaftliche Fragen entwickelt.
Interview
Olivia Girard: Wie sind Sie zu der Arbeit der Sektion gekommen?
Christiane Haid: Der Schlüssel und die Antwort auf Ihre Frage ist Novalis, den ich liebe, seit ich vierzehn bin. Während meiner Jahre in Heidelberg am Friedrich-von-Hardenberg-Institut schrieb ich meinen ersten Aufsatz über "Geschichte als Erinnerung an die Zukunft: Eine poetische Untersuchung". Dieser Text veranlasste Martina Maria Sam, mich 2001 als wissenschaftliche Mitarbeiterin nach Dornach zu holen, um die Sektion mit aufzubauen. Bis dahin hatte ich mich acht Jahre lang mit der Geschichte der Anthroposophie als weltweitem Kulturimpuls beschäftigt. Ab 2001 baute ich die Sektion für Bildende Kunst mit auf, bis ich in die Albert Steffen Stiftung berufen wurde. Dies führte dazu, dass ich mich noch intensiver mit dem Leben und Wirken des ersten Sektionsleiters Albert Steffen auseinandersetzte.
Während dieser Tätigkeit schrieb ich eine Dissertation zum Thema Mythos, Traum und Phantasie: Die kleinen Mythen von Albert Steffen an der Universität Hamburg, das 2012 im Schwabe Verlag Basel erschienen ist.
Danach war ich von 2009 bis 2025 Leiter der Sektion des Goetheanum Verlags. Im Jahr 2012 wurde ich gebeten, die Leitung der Sektion für Literatur- und Geisteswissenschaften zu übernehmen, die im Deutschen Sektion für die schönen Wissenschaften genannt wird. Wilhelm Oberhuber hatte mich bereits 2008 gefragt, ob ich die Redaktion von STILAber der richtige Zeitpunkt dafür kam erst 2020, als ich auch die Leitung der Sektion für Bildende Kunst übernahm. Gemeinsam mit meiner Kollegin Ariane Eichenberg habe ich erkannt, dass STIL bot eine ideale Gelegenheit, die zentralen Themen und Aufgaben der Arbeit der Sektionen sichtbar zu machen. Zu diesen Themen gehörten auch die Arbeiten und Biografien von Künstlern. Dieser Neuanfang fiel mit einer kompletten grafischen Neugestaltung des Magazins durch Wolfram Schildt aus Berlin zusammen. Die von Wolfram Schildt getroffenen gestalterischen Entscheidungen ergänzen die Themen des Magazins auf wunderbare Weise. Jede Ausgabe bringt neue Freude und Überraschungen.
Ariane Eichenberg: Ein paar Worte zu den beteiligten Personen.
Wenn ich zurücktrete und über dieses persönliche Element nachdenke, finde ich, dass solche menschlichen Begegnungen von grundlegender Bedeutung für Initiativen sind. Und doch werden diese Begegnungen von Mensch zu Mensch immer seltener.
Frank Teichmann hat mir die Augen für diese Sektion geöffnet. Er hielt viele Vorträge und Seminare in der Sektion für die schönen Wissenschaften - zum Beispiel über die ägyptischen und griechischen Mysterien, über Chartres und zuletzt über Goethe und die Rosenkreuzer.
Ich hatte Christiane Haid bereits in den 1990er Jahren auf einer Wilhelm Meister Konferenz. Obwohl es mehrere Jahre dauerte, bis wir unsere Zusammenarbeit begannen, war ein Faden zu dieser Zukunft gesponnen worden. Und nach einem langen Gespräch über die Wirkung von Literatur und Sprache auf den Menschen war klar, dass diese Fragen in den Mittelpunkt unserer Sektion für die schönen Wissenschaften gehören. Wie können Schrift und Sprache eine Brücke zum Geistigen sein?
Olivia Girard: Die Zeitschrift STIL hat eine lange Geschichte. Sie wurde 1979 gegründet, erscheint seit 2009 unter einem erweiterten Titel und wurde zu Michaelmas 2020 neu gestaltet und neu ausgerichtet. Wie würden Sie den roten Faden beschreiben, der die Zeitschrift über die Jahrzehnte getragen hat?
Christiane Haid: Nun, ich würde auf das außergewöhnlich hohe Niveau der Artikel hinweisen. STIL wurde als wissenschaftliche Zeitschrift gegründet und ist es bis heute geblieben. Als sie noch unter dem Namen "Goetheanistisches Bilden und Bauen" erschien, war sie in erster Linie eine Architekturzeitschrift. Das inhaltliche Spektrum hat sich jedoch stetig erweitert. In der Redaktionszeit von Michael Kurtz kamen Malerei, Musik, Literatur und bildende Kunst sowie verschiedene Aspekte der Kulturgeschichte hinzu. Außerdem gab es immer wieder Themenhefte, die sich einzelnen Ländern widmeten - zum Beispiel den britischen Inseln.
Die Sorge und das Interesse für das Menschsein, die Sorge und das Interesse für das menschliche Schaffen in allen Künsten - ebenso wie die Philosophie und die Anthroposophie - sind grundlegende Herzensanliegen, die den Kern der STIL.
Wir nähern uns diesem Thema aus zwei Blickwinkeln, die auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen mögen: aus der Sicht der Kunst und aus der Sicht der Wissenschaft. Kunst und Wissenschaft stehen jedoch tatsächlich im Mittelpunkt der Sektion für die schönen Wissenschaften. Der Ausgangspunkt ist natürlich Goethe, für den Kunst und Wissenschaft komplementäre Erkenntnisweisen waren. Goethe beschreibt auf wunderbar beeindruckende Weise, wie diese beiden zentralen menschlichen Aktivitäten aus einer gemeinsamen Quelle entspringen. Goethe verkörperte beide Kulturen, die der Kunst und die der Wissenschaft, und damit hat er unser Verständnis von Wissenschaft und Kunst grundlegend verändert. Man könnte sagen, dass Goethe Kunst und Wissenschaft vermenschlicht hat. Die Tatsache, dass Kunst und Wissenschaft heute immer noch getrennt zu sein scheinen, ist auf die Einstellungen des 18. und 19. Jahrhunderts zurückzuführen - zwei Jahrhunderte, die die Vorstellung von "zwei getrennten Kulturen" - Kunst und Wissenschaft - überhaupt erst entstehen ließen. Die Zukunft liegt in einer erneuten, bewusst gestalteten Wiedervereinigung von Kunst und Wissenschaft. Durch die Annäherung der Wissenschaft an die Kunst wird die Wissenschaft transformiert, neu auf den Menschen ausgerichtet und durch das Ideal der Schönheit zur Ganzheit erhoben. Die Kunst wiederum kann aus dem rein unbewussten und eher subjektiven Bereich zu etwas erhoben werden, das durch Gesetze erfasst und durch schöpferische und nicht-rationale Einsicht allgemein zugänglich gemacht werden kann.
Ariane Eichenberg: Die Zeitschrift wird in erster Linie von den Lesern getragen, die nicht nur ein Abonnement STIL sondern auch die, die es lesen und zu einer anderen Sichtweise angeregt werden. Andererseits bildet der goetheanistische Ansatz den roten Faden: das Künstlerische, das auf wissenschaftlich exakter Erkenntnis beruht, und das Wissenschaftliche, das durch das Individuum künstlerisch wird. Zu Michael Kurtz' Zeiten war es eher ein musikalischer Faden, während es in unserer Zeit mit Pieter van der Ree von der Sektion für Bildende Kunst ein sprachlich-philosophischer oder auch architektonischer Faden ist. Aber alles miteinander verwoben ist ein bleibendes Interesse am Verständnis von Kultur, Kunst, Wissenschaft und, im weitesten Sinne des Wortes, Religion. Wir bieten einen größeren Kontext, in dem diese Bereiche in unserer heutigen Welt verortet werden können.
Olivia Girard: Mit der Zeit hat sich auch der thematische Fokus erweitert. Welche Aspekte des Goetheanismus sind für Sie heute besonders wichtig?
Christiane Haid: Bei dem Wort Goetheanismus mag man an Protokollberichte, wissenschaftliche Methodik oder Biologie denken. Für uns steht hier Goethes Weltanschauung im Mittelpunkt, nämlich die Art und Weise, wie er beobachtete, forschte und reflektierte. Goethes Art zu sehen, zu reflektieren und zu forschen hat seine Kunst und seine Wissenschaft erst zur Blüte gebracht. Ein sehr früher Vortrag von Rudolf Steiner, Goethe als Vater einer neuen Wissenschaft der Ästhetikbringt unsere zentralen Anliegen wunderbar auf den Punkt.
Der Vortrag fordert uns auf, die materielle Welt durch künstlerische Tätigkeit zu erheben - und man könnte dies auch auf die wissenschaftliche Tätigkeit ausdehnen -, so dass die materielle Welt durch künstlerische/wissenschaftliche Tätigkeit transformiert wird. Es ist eine Art Auferstehungsprozess im rosenkreuzerischen Sinne.
Ariane Eichenberg: Für mich als Literaturwissenschaftler sind Literatur und Sprache ein zentrales Anliegen, und dazu gehört auch die Sprache der Anthroposophie und Rudolf Steiners. Das Hauptthema für Michaeli 2025 ist: Rudolf Steiner lesen und verstehen. Verschiedene Autoren erforschen die Sprache und die Denkprozesse Rudolf Steiners in seinen schriftlichen Werken. Für mich war es entscheidend, zu zeigen, wie sich das Geistige in der Sprache manifestiert, wenn wir gedankenvoll lesen und so den Text jedes Mal neu erschaffen, wenn wir uns mit ihm beschäftigen. Die Schrift ist eine "Partitur" (ein Ausdruck, den Rudolf Steiner für Die Philosophie der Freiheit und Ein Abriss der esoterischen Wissenschaft), die wir wiederholt üben können. Dabei geht es nicht um die Rezeption von Inhalten, sondern um die Bewegung von Gedanken. Dabei sind in einem ersten Schritt literarische Begriffe hilfreich, die aber in weiteren Schritten auf die Geisteswissenschaften übertragen werden müssen.
Olivia Girard: STIL wird nun vierteljährlich von der Sektion für Schöne Wissenschaften und der Sektion für Bildende Künste herausgegeben. Wie sieht diese Zusammenarbeit in der täglichen Redaktionspraxis aus?
Christiane Haid: Es ist eine sehr enge Verflechtung, genau wie ich es vorhin beschrieben habe. Beide Bereiche bereichern sich gegenseitig, ohne ihre Konturen zu verwischen, so dass es sich auch gesellschaftlich um zwei Kreise handelt, die ihre eigenen Kontexte mit sehr unterschiedlichen Menschen bilden, die aber auch voneinander lernen, sich gegenseitig herausfordern und sich gegenseitig bereichern.
Ariane Eichenberg: Die Sektionen für Schöne Wissenschaften und Bildende Kunst werden beide von Christiane Haid geleitet. Es gibt also bereits eine Verbindung und einen ständigen Austausch. Das zeigt sich zum Beispiel in der großen Rudolf Steiner-Ausstellung Entzündet durch den Geist des Kosmos.. am Goetheanum, die bis zum Sommer 2026 zu sehen sein wird.
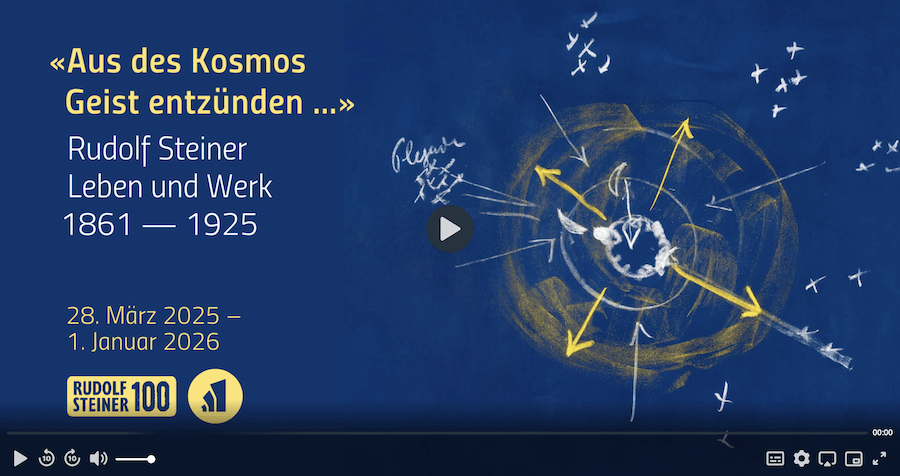 Klicken Sie hier, um das Video anzusehen.
Klicken Sie hier, um das Video anzusehen.
Christiane Haid hat die Ausstellung initiiert, Pieter van der Ree hat sie kuratiert, und wir haben uns gemeinsam über Texte und Bilder ausgetauscht. Das bedeutet auch eine enge Zusammenarbeit mit STIL. Stil wäre nicht STIL ohne die bildende Kunst. Er lebt von den Bildern und Kunstwerken und den Gesprächen mit den Künstlern.
Olivia Girard: In einem Zeitalter, das von digitalen Medien beherrscht wird, setzen Sie weiterhin auf ein gedrucktes Magazin. Welche Rolle spielt das gedruckte Format für Ihre Leser?
Christiane Haid: Wir legen großen Wert auf ein optisch und haptisch schönes und ansprechendes Design - etwas, das man in die Hand nehmen, anfassen und fühlen kann.
STIL ermöglicht es den Lesern, ihrem Bildschirmalltag zu entfliehen und eine kreative Pause ohne Strom und nervöse Reize einzulegen. Die Artikel sind oft anspruchsvoll und fordernd. Sie erfordern Konzentration und Ausdauer, da sie in der Regel viel länger sind als Artikel in anderen Zeitschriften. Das ist uns besonders wichtig, denn wir wollen tiefgehende Lektüre auf hohem Niveau bieten und hoffen, dass es auch in unserer schnelllebigen Welt immer Leserinnen und Leser gibt, die bereit sind, sich die Zeit zu nehmen und die Mühe zu machen. Die Ausgaben bleiben über ihr Erscheinungsdatum hinaus relevant. Dank ihrer thematischen Ausrichtung können sie wie Bücher immer wieder gelesen werden, auch noch nach Jahren.
Ariane Eichenberg: Das können wir nicht mit Sicherheit sagen, da wir keine Umfrage durchgeführt haben, um diese Frage zu bewerten. Ich gehe jedoch davon aus, dass wir Leser haben, die speziell dieses gedruckte Format wünschen. Unsere Artikel sind ungewöhnlich lang. Wir könnten aus jeder Ausgabe ein Buch machen. STIL. Darüber hinaus sind die Themen und die Sprache anspruchsvoll. Dies sind keine Texte, die man einfach überfliegen kann. Manchmal möchte man vielleicht zurückgehen und etwas noch einmal lesen; man möchte vielleicht sogar etwas hervorheben. Natürlich kann man all das auch im digitalen Format tun, aber insgesamt spricht das für eine gedruckte Ausgabe, die zum Verweilen einlädt. Für eine englische Version von STILdie in Arbeit ist, wollen wir jedoch zunächst ein digitales Format verwenden.
Ich persönlich bevorzuge die gedruckte Zeitschrift. Wenn ich etwas in einem Artikel suche, greife ich immer zu meinem Stapel von STIL Zeitschriften neben meinem Schreibtisch, und ich lese die gedruckte Version. Das schöne, schwere Papier, das große Format und die Aufmachung verleiten mich immer dazu, noch ein wenig weiter zu lesen und zu blättern.
Olivia Girard: Wenn Sie an die kommenden Jahre denken, welche Entwicklungen wünschen Sie sich für STIL und welche Themen würden Sie besonders gerne verfolgen?
Christiane Haid: Wir wollen mit unserer Zeitschrift innere Orientierung und Tiefe geben. Wir wollen auch kontroverse Themen ansprechen, ohne politisch zu werden. Es ist erstaunlich, dass Goethe sich in den Wirren der Französischen Revolution intensiv mit Persien und Hafis beschäftigt hat und dass Schiller seine Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen geschrieben hat. Mir scheint, dass die tiefe Wirkung der inneren kulturellen Bildung durch Dichtung, Kunst und Philosophie unterschätzt und heruntergespielt wird. Man sucht den großen Hebel und vergisst, dass es die feinen, leisen Töne und Impulse sind, die den Menschen berühren und verändern. Die Schwerpunkte der Zeitschriften ergeben sich oft aus den Inhalten der Tagungen, die die beiden Sektionen am Goetheanum durchführen. Aber auch aus der Wahrnehmung aktueller Ereignisse, aus Begegnungen mit Menschen und aus inneren Anliegen und Impulsen, die uns begegnen, versuchen wir, relevante Themen und Fragen aufzugreifen. Der 100. Todestag Rudolf Steiners scheint mir ein wichtiger Wendepunkt zu sein. Ich habe den Eindruck, dass es einen neuen Schritt der Anthroposophie in das kulturelle und zeitgeschichtliche Geschehen geben sollte, durchdrungen von Leben, ohne missionarischen Eifer oder überlegenes Wissen, sondern aus einem tiefen Interesse an den Menschen und ihren existenziellen Fragen, die sich in dieser herausfordernden und schwierigen Zeit stellen.
Ariane Eichenberg: Natürlich würden wir gerne mehr Leser haben. Wir wollen nicht an Flughäfen verkauft werden - dazu müssten wir uns zu sehr verbiegen! Aber es wäre hilfreich, wenn wir uns irgendwann selbst versorgen könnten. Es ist schön zu hören: "Was für ein tolles Magazin ihr da produziert!" Noch schöner wäre es, wenn mehr Leute sie kaufen und lesen würden. Das ist der äußere Aspekt. Ein internes Ziel ist es, die anthroposophischen Themen stärker mit den Phänomenen der Gegenwart zu verbinden. Zurzeit sind das vor allem Kriege, aber wir beschäftigen uns auch mit technologischen Entwicklungen, die unser Verständnis von Menschsein fast zerstören. In diese Abgründe hineinzuschauen, sie aus anthroposophischer Sicht zu betrachten und das Gesehene artikulieren zu können, ist eine zentrale Aufgabe.
Über den Herausgeber und Redakteur
Dr. phil. Christiane Haidgeboren 1965, studierte Germanistik, Geschichte, Kunst und Pädagogik in Freiburg und Hamburg. Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Friedrich-von-Hardenberg-Institut für Kulturwissenschaften, Forschung zur Geschichte der Anthroposophie im 20. 2001 Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Sektion Bildende Kunst. Ab 2006 Kulturwissenschaftler bei der Albert Steffen Stiftung in Dornach. Ab 2009 Leiterin des Goetheanum Verlags. Promotion in Literaturwissenschaft: Mythos, Traum und Imagination. Die kleinen Mythen von Albert Steffen, Basel 2012. Seit 2012 Leiterin der Sektion für Schöne Wissenschaften am Goetheanum. 2019 bis 2025 Programmleiter des Goetheanum Verlags. 2024 Leiterin des Kunststudienjahres am Goetheanum. Aktuelle Forschungsthemen: Humanisierung des Menschen durch Literatur, KI und Transhumanismus, Ästhetik und Rudolf Steiners Sinneslehre, Christian Morgenstern, Rilke, Novalis, Goethe, die Werke Rudolf Steiners u.a.
Dr. phil. Ariane Eichenberggeb. 1968; Studium der Anthroposophie in Stuttgart, der Germanistik und Slawistik in Heidelberg und Hamburg. Promotion über Shoah-Literatur; 2004 Mitarbeit am Forschungsprojekt "Erinnerung und Gedächtnis" am Kulturwissenschaftlichen Institut (KWI) in Essen. Ab 2005 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsprojekt "Die Suche nach Demokratie im Schatten der Gewalt. Konzepte von Familie und friedlicher Gesellschaft zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Beginn des 21. Jahrhunderts" (Köln). Von 2005 bis 2022 Redakteurin der Zeitschrift "Erziehungskunst". Seit 2007 Deutschlehrerin an der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe. 2010/11 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Stuttgart, 2012/13 an der Universität Tübingen. Seit 2015 Mitarbeiterin in der Sektion für Schöne Wissenschaften. Veröffentlichungen zu Gedächtnis und Erinnerung, zur literarischen Verarbeitung traumatischer Ereignisse. Forschungsschwerpunkt ist die Bedeutung von Literatur und Sprache im digitalen Zeitalter.
10.09.25